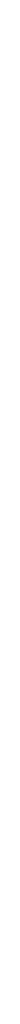Peter Krumpholz
Kultur und Religion unter der Perspektive von Religionspolitologie und Politischer Philosophie
Während Europa traditionell zwischen säkularer und religiöser Kultur schwankt, ist in den USA und im größten Teil der Welt die Bevölkerung mehrheitlich religiös. Internationale Konflikte bestehen daher u.a. zwischen dem europäischen Säkularismus, der Zivilreligion der USA und der politischen Religion des Islamismus. Jedoch ist der kulturreligiöse Konflikt zwischen Europa und dem Islamismus nicht nur ein außenpolitischer, sondern zugleich ein innereuropäischer Konflikt zwischen dem Islamismus und dem modernen Verfassungsstaat. In vielen europäischen Gesellschaften, so auch in der Bundesrepublik, sind Spannungen zwischen traditionellen Muslimen und dem pluralistischen Modell der Gesellschaft zu beobachten. Selbstredend sind dies nicht die einzigen Konflikte in unserer Gesellschaft.
Die Verknüpfung, Vermischung oder Vereinheitlichung von säkularen mit religiösen Wirklichkeitsinterpretationen bei Phänomenen des politisch-religiösen Extremismus sind heute zwar wohl bekannt. Indes gilt dies nicht nur für den politisch-religiösen Fundamentalismus, bei dem diese Zusammenhänge evident und mittlerweile unumstritten sind. Vielmehr betrifft dies auch den so genannten Links- und Rechtsextremismus. Kulturreligiöse Konflikte, die durch Materialismus und Pleonexie, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Transzendenzskepsis, Antireligiosität und Islamophobie, oder durch Re-Ethnisierung, Segregation, politisch-religiösen Fundamentalismus, bildungsferne Weltfremdheit und exklusive Gottesbegeisterung hervorgerufen werden, bedingen sich zumeist gegenseitig und gefährden so das gesellschaftliche Zusammenleben. Mentale und religiöse Differenzen unter Bürgerinnen und Bürgern führen insbesondere dann zu Konflikten, wenn sie durch exkludierende Nationalismen und integralistische Glaubenslehren fundiert werden. Auf der Grundlage partikularer Selbst-, Gesellschafts- und Weltdeutungen entstehen polarisierende Gegenüberstellungen von vermeintlich Gläubigen und Ungläubigen, von säkularer und religiöser Kultur. Durch positive Selbst- und negative Fremdkulturalisierung werden nationale und ethnisch-religiöse, vermeintlich homogene Kollektivgemeinschaften wie fundamental-dramatisierte Differenzen und Spaltungslinien konstruiert. Auf diese Weise werden exklusive Zugehörigkeiten imaginiert, die leicht zu Diffamierung, Dämonisierung und Ausgrenzung führen können.
Die sozialwissenschaftlichen Erklärungsversuche, die in der Vergangenheit zumeist die ökonomische und soziale Desintegration in den Mittelpunkt der Erforschung von Fremdenfeindlichkeit und Fundamentalismus stellten (vgl. u.a. W. Heitmeyer „Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland“, Ffm. 1997), greifen zu kurz. Doch gilt dies auch für kulturwissenschaftliche Forschungsansätze. Wer wie Samuel Huntington soziale Fragen ausgeklammert, die Kulturen mit den großen Weltreligionen identifiziert und allein in diesen die Hauptursache interkultureller Konflikte sieht (vgl. Kampf der Kulturen, München und Wien 1997, S.52), fragt nur unzureichend nach den konkreten Glaubensformen und säkularen Wertorientierungen der Menschen innerhalb einer Kultur. Die Ursache interkultureller oder interreligiöser Konflikte wird zudem aprioristisch im Glauben bzw. spezifischen Glaubensformen verortet, während säkulare Selbst- und Weltdeutungen unbeachtet bleiben und somit im vorhinein exkulpiert werden.
Den gegenwärtigen Herausforderungen angemessener sind Konzepte von Interkulturalität und Interreligiosität, die den Zusammenhang von Religion und Gewalt nicht ausblenden, darüber hinaus jedoch den Topos der Kultur weiter fassen als das Zusammenspiel von säkularer Vernunft und Religion, wie z.B. Ratzinger, und somit auch in der Lage sind, die Frage aufzuwerfen, ob diese „sich gegenseitig begrenzen und je in ihre Schranken weisen und auf ihren positiven Weg bringen“ können (Werte in Zeiten des Umbruchs – Die Herausforderungen der Zukunft bestehen, Freiburg 2005, S. 32).
Im gegenwärtigen Prozess der globalen Begegnung und Durchdringung der Kulturen hängt die Frage nach einer ethischen Grundlage für ein kulturreligiöses, d.h. interkulturelles und interreligiöses Miteinander nicht nur davon ab, ob es zwischen den kulturellen Räumen der Welt zu einer polyphonen Korrelationalität von Vernunft und Religion, säkularen Weltsichten und der Vielfalt der Glaubensformen kommt. Weil es auch innerhalb der kulturellen Räume keine Einheitlichkeit gibt, gilt dies vielmehr auch für die europäischen Gesellschaften. Es kommt darauf an, die gegenwärtigen Pathologien in den Religionen wie die Hybris der säkularen Weltanschauungen, gleichermaßen erkannt, zu kontrollieren. Um die Chancen und Gefährdungen der demokratischen, plural-religiösen Kultur zu verstehen, müssen daher die von den Menschen je geglaubten Existenz- und Weltdeutungen – seien sie primär religiöser oder säkularer Ausrichtung – empirisch erforscht und die vor Ort gewonnen Befunde in praktische Modellvorhaben einbezogen werden. Eine differenzierte Vorgehensweise ist notwendig, um einerseits der fundamentalistischen und fremdenfeindlichen Dramatisierung und andererseits der Verharmlosung der Herausforderungen und Probleme entgegenzuwirken, die sich aus dem interkulturellen und plural-religiösen Zusammenleben ergeben können.
Um den politischen und gesellschaftlichen Akteuren vor Ort kulturreligiöse Handlungsalternativen jenseits rein ökonomischer, reaktiv-juridischer, säkular-kultureller oder interreligiöser Maßnahmen eröffnen zu können, ist ein neues Verständnis von Kultur erforderlich, das soziale Fragen nicht ausklammert und interkulturelle mit interreligiösen Ansätzen verknüpft. Wer den Topos der Kultur exklusiv in einem nur idealistischen oder lediglich materialistischen Sinne versteht, z.B. allein als Religion, bloß als Politik oder nur als Wirtschaft, ist mit diesem einseitigen Kulturverständnis bereits dabei, freiwillig oder nicht, einen Beitrag zum so genannten Kampf der Kulturen zu leisten. Wer hingegen den Topos der Kultur inklusiv als Religion, Politik und Wirtschaft etc. bestimmt, ist in der Gefahr, alle Bereiche des menschlichen Denkens und Tuns zu kulturalisieren und die relative Eigenständigkeit des religiösen, politischen und wirtschaftlichen Handelns zu unterschätzen. Die vermeintliche Substanz der Kultur ist weder – um den Streit zwischen Idealisten und Materialisten nicht fruchtlos fortzuführen – die Religion oder die Wirtschaft, noch sind es – um den Streit zwischen exklusiven Reduktionisten und inklusiven Ideologen nicht zugunsten letzterer zu entscheiden – Religion, Politik und Wirtschaft. Im Sinne eines Modells der wechselseitigen Begrenzung und Abhängigkeit kommt es daher darauf an, Kultur nicht in einem substanziellen, sondern im grundbezogen-relationalen Sinne vor allem als das Verhältnis von Religion, Politik und Wirtschaft zu begreifen, wie es empirisch vorherrschend ist und ethisch sein sollte. Auf der Grundlage eines solchen Kulturverständnisses ist es zudem erforderlich, kulturreligiöse Bildungs- und Begegnungskonzepte zu entwickeln und zu erproben, nicht zuletzt weil in der praktischen Kulturarbeit bisher oftmals die säkular orientierten Freunde der Aufklärung zumeist eben so unter ihresgleichen geblieben sind wie die Freunde der Religion. Während erstere vornehmlich den interkulturellen Dialog pflegten, blieben letztere im interreligiösen Dialog allzu oft unter sich. Wer indes Religion verkennt, kann Kultur nicht erkennen. Wer hingegen Kultur auf Religion reduziert, dem dürfte es schwer fallen, die relative Eigenständigkeit der säkularen Sphäre anzuerkennen.
Da bei Phänomenen wie Fundamentalismus, Nationalismus und Rassismus der Zusammenhang zwischen säkularer und religiöser Wirklichkeitsinterpretation evident ist, ist es in der kulturreligiösen Forschungspraxis unumgänglich, auch religionspolitologische Forschungsansätze aufzugreifen (vgl. Bärsch: Zweck und Inhalte der Religionspolitologie. In: Bärsch, Berghoff und Sonnenschmidt: Wer Religion verkennt, erkennt Politik nicht - Perspektiven der Religionspolitologie, Würzburg 2005).
Im Zentrum der Religionspolitologie steht der Zusammenhang zwischen dem Bewusstsein von Mensch, Gesellschaft und Geschichte und der Religiosität oder deren Negation. Erforscht wird deshalb auch nicht nur, „ob und wie die Menschen ihre Existenz religiös deuten“, sondern darüber hinaus, „ob sie ein religiöses Bewusstsein von der gesellschaftlichen Ordnung haben und ob ihre Entscheidungen über die Ordnung der Gesellschaft unbewusst durch ihre Religiosität beeinflusst werden“ (ebenda, S. 15).
Im Unterschied zu bisherigen Forschungen ist daher nicht die Religion allein der Gegenstand der Religionspolitologie, sondern das Verhältnis von Politik und Religion. Der religionspolitologische Forschungsansatz ist deshalb auch nicht primär an der Beziehung zwischen den Kollektivsubjekten ‚Staat’ und ‚Kirche’ – mit anderen Worten: der kollektiven Identität des ‚Staates’ und der ‚Kirche’ – orientiert. Denn die vorschnelle Verwendung des Begriffes ‚Staat’ bzw. primäre Orientierung am Staat stünde im Widerspruch zu Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes. Nach Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 ist nicht der ‚Staat’ maßgebend, sondern das Volk: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ und (Satz 2): „Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“. Das Volk wiederum ist mit der Kategorie des Pluralismus wahrzunehmen. Es besteht aus vielen von einander zu unterscheidenden Menschen. Im Unterschied zu anderen Forschungskonzeptionen wird daher von der Religionspolitologie auch die Differenz zwischen Regierenden und Regierten berücksichtigt. Daraus folgt, dass nicht nur erforscht wird, wie die Bevölkerung das Verhältnis von Politik und Religion wahrnimmt, sondern auch erfasst wird, wie dieses Verhältnis von politischen Entscheidern und Parlamentariern gedeutet wird.
Von der Religionspolitologie wird also nicht nur die Religiosität der Menschen bzw. das erforscht, woran die Herrschenden und Beherrschten, die Regierenden und Regierten sowie die Befehlenden und Gehorchenden gemeinsam oder nicht (mehr) gemeinsam glauben. Die Besonderheit des religionspolitologischen Forschungsansatzes besteht vielmehr darin, dass vor allem nach der kulturellen und politischen Bedeutung der Religiosität (oder deren Negation) der Menschen für ihr jeweiliges Bewusstsein von der gesellschaftlichen Ordnung gefragt wird. Ausgehend von der religiösen ebenso wie der areligiösen Selbstwahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger kommt es der Religionspolitologie sowohl darauf an, zu ermitteln, welche politischen Implikationen die unterschiedlichen Formen ihrer Religiosität haben, als auch darauf an, herauszufinden, welche kulturelle und politische Bedeutung ihre Religionskritik oder Areligiosität haben, um darauf aufbauend eine religionspolitologische und kulturreligiöse Politikberatung etablieren und empirisch fundierte Bildungs- und Begegnungskonzepte für die Bevölkerung und politische Entscheider entwickeln und erproben zu können.
Jenseits der Frage, ob man für oder wider eine Religion oder gar die Religion ist, kann von der Religionspolitologie – was im Zeitalter der Mondialisierung von besonderer Bedeutung ist, da an immer mehr Orten der Welt Menschen mit unterschiedlichen Glaubensformen und säkularen Weltsichten leben und daher neue, interkulturelle und interreligiöse Regeln der Koexistenz finden müssen – erstmals in vergleichender Perspektive erfasst werden, wie Gläubige, Andersgläubige und Nicht-Gläubige das Verhältnis von Religion und Politik deuten. Weder Religion noch Religionskritik oder Säkularität werden dabei ausschließlich im Modus des Konflikts und eines erneuerten Kulturkampfes als Dispositive politisch oder religiös motivierter Gewaltbereitschaft wahrgenommen. Gefragt wird mithin sowohl danach, welche Inhalte des Glaubens als auch danach, welche Gehalte des säkularen Bewusstseins der demokratischen Kultur förderlich sind bzw. diese bereichern und welche Glaubens- oder säkularen Bewusstseinsformen abträglich sind, zu Fanatismus und Fatalismus tendieren und die politisch oder religiös motivierte Gewaltbereitschaft begünstigen. Ausgehend von einer Korrelationalität von Vernunft und Glaube kann sowohl danach gefragt werden, welche säkularen Deutungsmuster, als auch danach, welche Formen der Religiosität mit Fremdenfeindlichkeit einhergehen und das interkulturelle und interreligiöse Miteinander gefährden. Erstmals kann in vergleichender Perspektive erfasst werden, wie verbreitet einerseits religiöse Pathologien und andererseits säkulare Hybris sind. Denn gerade im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen der Integration kommt es darauf an, nicht isoliert die – möglicherweise nicht vorhandene – Verfassungsloyalität z.B. von Muslimen (vgl. hierzu Brettfeld und Wetzels, Muslime in Deutschland, Hamburg 2007), sondern auch diejenige von Säkularisten, Christen, Juden und postkonfessionell Gläubigen zu erfassen. Erst in vergleichender Perspektive kann eine politische Gewichtung der Befunde vorgenommen werden, die sich nicht leichtfertig dem Vorwurf der Dramatisierung oder Verharmlosung einer Gruppe aussetzt.
Um die Chancen und Gefährdungen der freiheitlich-demokratischen und plural-religiösen Kultur heute erkennen zu können, ist es erforderlich, die sozialdominanten Selbst-, Gesellschafts- und Weltdeutungen der Bürgerinnen und Bürger – seien diese primär religiöser oder säkularer Ausrichtung – empirisch zu erforschen und die wahrscheinlichen Folgen dieser Deutungen für das kulturelle Mit- oder Gegeneinander bzw. deren jeweilige Vor- und Nachteile für ein gelingendes Miteinander herauszustellen. Es kommt je nach kultureller Konstellation und empirischer Verbreitung darauf an, sowohl den fundamentalistischen und fremdenfeindlichen Dramatisierungen als auch der pseudo-liberalen Verharmlosung der Herausforderungen entgegenwirken zu können, mit denen gegenwärtig auf das interkulturelle und plural-religiöse Mit-, Neben-, Durch- und Gegeneinander reagiert wird.
Zwecks Grundlegung einer präventiv ausgerichteten Politikberatung ist es nicht zuletzt erforderlich, auch die Wechselbeziehungen von Gläubigen zu Andersgläubigen und Nicht-Gläubigen zu erfassen. Denn damit kann ein Beitrag zu einer nicht allein reaktiven, sei es nun juristisch oder polizeilich, sondern präventiv ausgerichteten religionspolitologischen Politikberatung geleistet werden, die auf eine Förderung des kritisch-loyalen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger sowohl für die politischen Implikationen ihrer Religiosität als auch für die religiösen Implikationen ihres politischen Handelns abzielt, zumal das Bewusstsein für die religiösen Implikationen säkularer Selbst- und Weltdeutungen mäßig ausgeprägt ist. Unter den Bedingungen des religiösen und weltanschaulichen Pluralismus in (post)säkularen Gesellschaften, in denen der Glaube an Gott zu einer Option neben vielen anderen geworden ist, erfordert eine lebendige Verfassungskultur einen zivilen Wettbewerb der Weltsichten und Wettstreit um Werte unter den gläubigen, andersgläubigen und nichtgläubigen Bürgerinnen und Bürgern um die Vor- und Nachteile religiöser und säkularer Selbstdeutungen. Darum ist es, auch aufgrund der praxisorientierten Zielsetzung unserer Forschungen, notwendig, weder die Religiosität noch die Areligiosität der Bürgerinnen und Bürger vorschnell zu bewerten, sondern zunächst einmal empirisch nachzuvollziehen und zu verstehen. Nur wenn die religiösen, religionskritischen und areligiösen Motive und Voraussetzungen ihrer politischen Entscheidungen eruiert werden, können darauf basierend religionspolitologische und kulturreligiöse Politikberatungs- und Bildungskonzepte entwickelt werden, die das gegenwärtige Bewusstsein der Menschen, wie sie sich selbst und ihre gesellschaftliche Existenz wahrnehmen und deuten, und ihre jeweiligen Handlungsorientierungen zum Ausgangspunkt nehmen. Da eine Politikberatung empirisch fundierte Kenntnisse voraussetzt, wie sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch Mandatsträger und Parlamentarier das Verhältnis von Politik und Religion wahrnehmen, sind stets auch die Regierenden, also politische Entscheidungsträger, in die Forschungen und Projekte mit einzubeziehen.
Im Hinblick auf das stets relevante Problem der Konstituierung kollektiver Identität – mag sie als vernünftig oder unvernünftig gelten – wird mit Hilfe der Kategorien Differenz, Negation, Inklusion oder Exklusion deutlich, wie es zu einer Verknüpfung von Politik und Religion kommen kann und welche Folgen wiederum wahrscheinlich sind. Mit anderen Worten: wenn Menschen aufgrund ihrer religiösen Weltanschauung zu der Überzeugung gelangen, dass zur Herstellung ihrer eigenen Identität die Negation des anderen zwingend erforderlich ist, so hat dies in jedem Fall politische Folgen. Es kann sein, dass eine Zivilreligion das Gebot der Gleichheit aller Menschen und Gesellschaften vor Gott enthält. Es ist hingegen auch möglich, dass sich positive Selbstbestimmung und negative Fremdbestimmung wechselseitig ergänzen. Wird z.B. bei einer politischen Religion an einen Kampf zwischen Gott und dem Bösen geglaubt und ist die exklusive Beziehung zwischen Gott und dem eigenen Kollektiv konstitutiv für die kollektive Identität, so muss die Differenz zu den Mitgliedern anderer Kollektive nicht nur den Charakter der Negation haben; sondern es kann fest daran geglaubt werden, dass das jeweils andere Kollektiv vom Bösen unterminiert ist und deren Mitglieder bekämpft oder sogar vernichtet werden müssen. Im Anschluss an die Forschungsergebnisse von Claus-E. Bärsch (vgl. ders., Die politische Religion des Nationalsozialismus, München 2002) schlagen wir folgende allgemeine Merkmale zur Kennzeichnung einer Pathologie des Religiösen vor:
1. Der unerschütterliche Glaube an die Übereinstimmung des jeweils eigenen, konkreten Willens mit dem Willen Gottes.
Die Grundlagen solchen fundamentalen Größenwahns sind das vermeintliche Wissen, zu dem allmächtigen Gott eine außerordentlich-unmittelbare Beziehung zu besitzen, Gott im eigenen Selbst zu haben sowie an die Gottgleichheit der eigenen Seele oder des eigenen Kollektivs zu glauben.
2.Der Glaube an die vom Satan oder dem Teufel bewirkte Personifikation des metaphysisch Bösen im einzelnen Menschen oder in menschlichen Kollektiven.
3. Der Glaube, zukünftiges Heil schon in dieser Welt durch die Vernichtung der Bösen durch menschliche Taten herbeiführen zu können oder zu müssen.
Dies hat eine fatale Konsequenz: der total heilige Zweck der zukünftigen Erlösung vom Bösen heiligt alle Mittel. Darüber hinaus ist die Vernichtung der Bösen nicht nur eine Option, sondern wird zum Zwang.
In der religionspolitologischen Forschung geht es indes nicht nur um die empirische, historische und theoretische Erforschung politischer Aussagen und Symbole in Glaubensformen, Religionen und Theologien. Gegenstand des Interesses sind auch religiöse Implikationen politischer Ideen, säkularer Handlungen und Ordnungen. Ein Verständnis kulturreligiöser, d.h. vor allem politisch-religiöser oder religiös-politischer Konflikte ist heute nur möglich, wenn bei säkularen Weltdeutungen die religiösen Implikationen ebenso beachtet werden wie bei religiösen Selbstdeutungen die säkularen.
Es gilt daher zu berücksichtigen, dass politisch-religiöse oder religiös-politische Konflikte und Kulturkämpfe auch aus vordergründig säkularen Selbst-, Gesellschafts- und Weltdeutungen resultieren können. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn innerweltliche Bezugspunkte an die Stelle von transzendentem Sein und Seinsgrund gerückt und kryptoreligiös oder traditionelle Religionen substituierend verabsolutiert werden. Wenn die eigene Existenz beispielsweise allein autonom, lediglich sozionom oder nur physionom gedeutet wird, führt dies leicht dazu, dass auch die politischen Handlungsmöglichkeiten und -grenzen entweder grob über- oder aber unterschätzt werden. Die Pluralität und wechselseitige Ergänzung wie Begrenzung der Grundwerte der Verfassung kann dann nicht mehr erkannt werden. Es kann in Extremfällen sein, dass die Meinung vertreten wird, dass entweder das Leben des Einzelnen durch die Gesellschaft, in der man lebt, oder durch die Tradition und Geschichte des Volkes, dem man sich zurechnet, oder aber durch die Gesetze der Natur bzw. physischen Welt vollständig bestimmt sind oder werden sollten. Es ist indes auch möglich, dass das Selbstbewusstsein der Menschen nicht ausschließlich in Abhängigkeit von ihrem Bewusstsein von Gesellschaft, Geschichte oder Welt und Natur bestimmt wird. Vielmehr kann diesen Haltungen entgegengesetzt die Meinung vertreten werden, dass der Mensch frei von allem sei und sein Leben in jeder Hinsicht selbst bestimmen könne und solle, wenn er es nur wolle und durch andere nicht daran gehindert werde.
Wie dem auch sei: Aus der Perspektive der Religionspolitologie gilt es zu bedenken, dass im malumtypologisch zugespitzten Sinne Welt und Existenz – je nachdem ob diese religiös oder säkular gedeutet werden, ob Gott, Götter, überirdische Wesen oder höhere Mächte, der einzelne Mensch, die Gesellschaft oder die Natur das Kristallisationszentrum der Realitätsauffassung bilden – allein theo-, auto-, sozio- oder physionom gedeutet werden können. Im Extremfall könnte es sein, dass beispielsweise geglaubt wird, Gott sei jenseits der Welt ohne jedweden Bezug zu einer für den Menschen ganz bedeutungslosen Welt. Wenn geglaubt wird, dass diese eher früher als später untergehen werde, dann liegt der Gedanke nahe, dem Fall dessen, was ohnehin in seiner Hinfälligkeit und Verdorbenheit dem Untergang geweiht sei, tatkräftig nachzuhelfen. Es kann aber auch die Meinung vertreten werden, dass der letzte Grund nur in der Welt, in Teilen der Welt oder im eigenen Selbst zu verorten sei. Es muss, mit anderen Worten, einerseits damit gerechnet werden, dass der Glaube an eine Bestimmung durch Gott die Gläubigen dazu verführt, die Selbstbestimmung der Menschen in kultureller, gesellschaftspolitischer und ökonomischer Hinsicht zu substituieren; und andererseits damit, dass die Grenzen der Selbstbestimmung übergangen oder die Abhängigkeit von der Natur im Übermaß hervorgehoben wird, indem man sich dem Bewusstsein und Gefühl „schlechthinniger Abhängigkeit“ (Schleiermacher 1889, 27) bzw. dem, „was uns unbedingt angeht“ (Tillich 1956, 19ff.), verschließt.
Es muss jedoch nicht nur damit gerechnet werden, dass eine unvollständige, nicht allen Seinsdimensionen und Daseinssphären gegenüber offene Selbstdeutung ausgebildet wird und damit die Handlungsmöglichkeiten grob über- oder unterschätzt werden. Vielmehr dürfte es im Zeitalter der Globalisierung eher selten der Fall sein, dass gänzlich ohne Kenntnis anderer Glaubens- und Weltanschauungsformen die eigene Existenz auf nur eine oder wenige Dimensionen reduziert gedeutet wird. Da die rigide Apperzeptionsverweigerung in Anbetracht der weltweiten Vernetzung der Menschen eher die Ausnahme, und das Befremden, die Geringschätzung oder Abwertung als Kompensationsstrategie eher die Regel sein dürfte, muss heute vor allem damit gerechnet werden, dass politisch-religiöse Konflikte aus einer bestimmten Konnexität von erfahrenen oder konstruierten Glaubens- und Existenzdeutungsdifferenzen und seltener aus einseitig-reduktionistischen Weltanschauungen ohne ausdrücklichen Bezug auf andere resultieren. Wenn Weltanschauungsdifferenzen verstärkt zur Kenntnis genommen und damit bisherige Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden, dürfte es vor allem dann zu Konflikten kommen, wenn in Reaktion hierauf vermeintliche oder tatsächliche Differenzen nicht mehr schlicht verleugnet und ausgeblendet werden, sondern wenn diese - zum Zwecke der Stabilisierung bisheriger Selbstverständlichkeiten bzw. der Wiederherstellung der Geschlossenheit und Homogenität der eigenen Weltanschauung - einseitig oder gar wechselseitig fundamentalisiert und auf vermeintlich homogene Kollektive bezogen werden und ein Prozess der positiven Selbst- und der negativen Fremdkulturalisierung in Gang gesetzt wird.
Kurzum: Nur wenn vordergründig säkulare wie religiöse Entgleisungen im Kontext aufeinander bezogener Diskurse beachtet werden, können ein- oder wechselseitige Fundamentalisierungen von Differenzen angemessen erkannt und in ihrer empirischen Relevanz bzw. Verbreitung unter den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt erfasst und gewichtet werden. Ohne Rezeption des theoretischen Hintergrunds der Religionspolitologie ist ein Verständnis von kulturreligiösen Konflikten in religiös wie säkular pluralen Gesellschaften, in denen Religiosität zu einer Option unter vielen geworden ist, nicht mehr möglich.
Interkulturalität betrifft nicht nur das Zusammenleben von Deutschen mit Ausländern oder von Menschen mit Migrationshintergrund mit Menschen ohne Migrationshintergrund. Ein solches Verständnis von Interkulturalität, dass heute in der Öffentlichkeit und bisweilen auch in den Wissenschaften und der interkulturellen Pädagogik vorherrschend ist, beruht auf einem verkürzten, lediglich sozialem und nicht mehr personalem Verständnis von Kultur. Unter Kultur wird daher nicht mehr die Kultivierung und Zivilisierung der Persönlichkeit oder die individuelle wie arbeitsteilig gemeinsame Pflege der menschlichen und außermenschlichen Natur und das daraus resultierende Zusammenleben von Menschen mit gemeinsamen und unterschiedlichen – mehr oder weniger zivilisierten – Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wertvorstellungen, Lebensstilen und Präferenzen verstanden, sondern die Besonderheit einer Gruppe von Menschen im Gegensatz zu anderen. Meist orientiert man sich bei der Herstellung des Gruppenbezugs an den politisch organisierten Gesellschaften, den sog. Nationalstaaten. Ein solches Verständnis von Kultur ist jedoch nach innen hin stark homogenisierend bzw. vereinheitlichend und nach außen hin entschieden abgrenzend (vgl. hierzu grundlegend: Wolfgang Welsch, Transkulturalität – Die veränderte Verfassung heutiger Kulturen). Nicht zuletzt widerspricht es dem Selbstverständnis einer pluralen Gesellschaft. Es führt dazu, dass auch diejenigen, die das interkulturelle Miteinander fördern wollen, das „Inter“ (Zwischen) in „Interkulturalität“ auf das beziehen, was zwischen Menschen aus unterschiedlichen Gruppen sich ereignet, und nicht schlicht auf das, was konkret zwischen Menschen stattfindet, nämlich auf das Zwischenmenschliche. Obwohl man zu einem Dialog der Kulturen beitragen und Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen überwinden möchte, trägt man mit einem unreflektierten, ausschließlich kollektivistischen Verständnis von Kultur zur Homogenisierung der eigenen Gruppe und ihrer Separierung von anderen Gruppen bei und damit auch zur Schaffung von Problemen, die man doch eigentlich überwinden möchte. Um dies zu vermeiden, schlagen wir vor, nicht nur ein gruppenbezogenes, sondern auch ein personales Verständnis von Kultur und Interkulturalität auszubilden. Es kommt also darauf an, nicht allein die Zugehörigkeit der Menschen zu einer national, ethnisch, staatlich, sprachlich oder religiös bestimmten Gemeinschaft in den Mittelpunkt des Kulturverständnisses zu stellen, sondern ein Verständnis auszubilden, dass von den Kenntnissen und Fertigkeiten, Lebensstilen, Wertvorstellungen und Vorlieben konkreter Menschen ausgeht. Versteht man auf diese Weise unter Kultur nicht ausschließlich ein soziales, sondern zunächst einmal ein personales Phänomen, dann kann auch unter Interkulturalität mehr als nur das Mit-, Neben-, Durch- und Gegeneinander von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen / Staaten verstanden werden. Es können a) über die Unterschiede zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen hinaus, auch b) die Unterschiede zwischen Menschen in einer Kultur und c) die kulturenübergreifenden Gemeinsamkeiten von Menschen aus verschiedenen Kulturgemeinschaften berücksichtigt werden. Wir schlagen daher vor, unter Interkulturalität folgendes zu verstehen:
1. Das Mit- oder Nebeneinander von Menschen a) mit unterschiedlichen, ähnlichen oder gemeinsam geteilten Kenntnissen, Fähig- und Fertigkeiten, Lebensstilen, Wertvorstellungen, Glaubensformen und ästhetischen Vorlieben, und b) ihr Bewusstsein dafür, was ihnen als Menschen und verschiedenen Gruppen von Menschen gemeinsam ist und was nicht.
2. Die Konflikte und Spannungen zwischen Menschen mit vermeintlich oder tatsächlich unterschiedlichen Glaubensformen, Weltdeutungen und Wertorientierungen, die vor allem aus einer Dramatisierung oder Verharmlosung von Glaubens- und Weltdeutungsdifferenzen und daraus resultieren, dass a) Unterschiede zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, b) Unterschiede zwischen Menschen in einer Kultur und c) kulturübergreifende Gemeinsamkeiten von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen entweder über- oder unterbewertet bzw. dramatisiert oder ausgeblendet werden.
3. Paradigmen und Prinzipien, die einen Umgang mit diesen Konflikten eröffnen und deren Mäßigung fördern können, indem sie das Bewusstsein der Menschen dafür fördern, was ihnen allen als Mensch und Gruppe gemeinsam sein sollte und was besser nicht. Hierunter fallen nicht nur Empathie, Rollendistanz und Ambiguitätstoleranz gegenüber Menschen aus einer anderen Kultur, wie interkulturelle Pädagogen bisweilen meinen. Hierzu gehören aber auch nicht allein Bilderverbot, zehn Gebote, Bergpredigt und Nächstenliebe. In unserer Gesellschaft kommen als Paradigmen, die bestimmen, woran wir unser politisches und zwischenmenschlich-öffentliches Handeln gemeinsam orientieren sollten, vor allem die Pluralität der im Grundgesetz angeführten Werte (Verantwortung vor Gott und den Menschen, Würde, Freiheit, Gleichheit etc.) in Frage - eine Pluralität, die implizit ein Konfliktbewusstsein für konkurrierende, allgemein menschliche und bürgerliche Werte und die Notwendigkeit einer Abwägung zwischen konkurrierenden Gütern umfasst.
Da indes von der Öffentlichkeit gegenwärtig noch a) Migration, Kampf oder Dialog der Kulturen, Vielfalt und Integration als zentrale Herausforderungen unserer Gesellschaft betrachtet werden, und weil dabei im heutigen Alltagsverständnis b) unter Kultur zumeist die Besonderheit einer Gruppe im Gegensatz zu allen anderen Gruppen und c) unter Interkulturalität meistens ein gelingendes Miteinander von Einheimischen mit Zugewanderten verstanden werden, werden von der Öffentlichkeit in aller Regel zunächst auch die Unterschiede zwischen Menschen aus diesen beiden Gruppen bemerkt. Dabei werden – je nach Standpunkt – Differenzen entweder als Problem und Defizit oder aber Ressource und Chance begriffen. Während die Befürworter der multikulturellen Gesellschaft hervorheben, dass sie über Toleranz und Anerkennung der Vielfalt hinaus diese als Chance begreifen und nutzen wollen, betonen andere, dass bestehende Differenzen zwischen den Kulturen bzw. zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen durch Integrationsbemühungen zu überbrücken sind. Beiden gemeinsam ist jedoch, dass sie auf migrationsspezifische Besonderheiten und auf Differenzen zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen abzielen und dazu tendieren, diese Unterschiede zu überschätzen und die Unterschiede in einer Kultur ebenso wie die Kulturen übergreifenden Gemeinsamkeiten der Menschen zu unterschätzen.
Im Verlauf eines interkulturellen Beratungsprozesses oder einer interkulturellen Öffnung kann zwar zunächst der Aspekt der Differenz zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen im Vordergrund stehen, zumal dieser gemeinhin von der Bevölkerung auch als erstes bemerkt wird. Erste Schritte zu einer interkulturellen Kontextualisierung können durchaus in der Bildung von migrationsspezifischen und kulturspezifischen Hypothesen bestehen. Sofern diese indes allein verwendet werden, besteht stets die Gefahr einer Ethnisierung von Kultur, weil in diesem Kontext der Begriff der Kultur zumeist auf die Kultur eines Volkes bezogen oder allein in der einen oder anderen Form als Kollektivkategorie benutzt wird. Um nicht nur die Unterschiede bzw. Besonderheiten zwischen den Kulturen zu beachten, sondern um darüber hinaus auch die Vielfalt in den Kulturen und die Unterschiede zwischen Menschen in einer Kultur (=Intrakulturalität) sowie die Gemeinsamkeiten von Menschen aus verschiedenen Kulturen bzw. über Kulturgrenzen hinaus (=Transkulturalität) erfassen zu können, erachten wir es darüber hinaus für unabdingbar, dass auch intra- und transkulturelle Hypothesen gebildet werden. Bei intra- und transkulturellen Hypothesen kommt es vor allem darauf an, dass vorhandene Probleme a) auf die Vielfalt der Menschen in einer Kultur und b) auf kulturübergreifende Gemeinsamkeiten von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zurückgeführt werden (z.B. auf Alter, Glaube, Geschlecht, Bildung, Einkommen, Milieu- und Schichtzugehörigkeit, aber auch auf persönliche Besonderheiten, Ideosynkrasien und Wertorientierungen). Es ist allen Menschen kulturübergreifend gemeinsam, dass sie in Kulturen leben, in denen es in der einen oder anderen Form z.B. Spannungen zwischen Religion, Kunst, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bzw. Konflikte zwischen Menschen mit unterschiedlichen Wertorientierungen gibt. Ein Verständnis für diese Konflikte dürfte indes erst dann erreicht werden, wenn wir diese Konflikte auch als intrapsychische oder personale Konflikte begreifen, die aus der Pluralität unserer Bedürfnisse und Zielsetzungen resultieren.
Wie dem auch sei, die aktuellen Herausforderungen des interkulturellen Mit-, Neben-, Durch- und Gegeneinanders können nur interdisziplinär erforscht werden. Wer interkulturelle Prozesse theoretisch und empirisch untersuchen, praktisch begleiten und politisch-beratend mitgestalten will, sollte ökonomische, soziale, pädagogische, politische, psychologische, religiöse und sonstige Interdependenzen beachten. Interdisziplinäre Forschung zur Erfassung von Interdependenzen in der Praxis setzt jedoch fachwissenschaftliche Kompetenzen und einen übergeordneten Bezugspunkt zur Verknüpfung der verfügbaren Fachkompetenzen voraus. Dies führt in der Forschungspraxis oftmals dazu, dass die Möglichkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit stark eingeschränkt werden, auch wenn dies nicht immer offen eingeräumt wird. Abschließend wird hier daher noch angedeutet, warum es in der interkulturellen Forschungspraxis nicht nur förderlich ist, auf die Religionspolitologie im Besonderen, sondern auf die Philosophie als Metawissenschaft im Allgemeinen zu rekurrieren.
Die Philosophie kann für interdisziplinäre Zwecke als Metawissenschaft fungieren, weil es neben der theoretischen Philosophie, die auf den Grund des Seins und damit auf eine „Zusammenschau der gegenseitigen Verwandtschaft der Wissenschaften und der Natur des Seienden“ (Platon, Politeia 537c) gerichtet ist, seit langem etablierte, spezielle Philosophien für die menschlichen Angelegenheiten gibt. Mit der Politischen und Pädagogischen Philosophie sowie der Religions-, Sozial- und Kulturphilosophie verfügt die Philosophie insbesondere über ein Wissen zur interdisziplinären Erfassung von Interdependenzen zwischen denjenigen Forschungsgegenständen, die es zwecks Ausbildung interkultureller Kompetenzen notwendigerweise zu berücksichtigen gilt.
Als Metawissenschaft ist die Philosophie nicht zuletzt dann besonders gut geeignet, wenn Philosophen die Unterschiede zwischen Theologie, Philosophie, Wissenschaft und Praxis hervorheben (so z.B. K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, München 1962, S. 95ff.). Denn auch Philosophen haben in Vergangenheit und Gegenwart leider nur allzu selten der Versuchung widerstehen können, sich einseitig der Theologie und den Religionen oder der Politik und dem Praktisch-Werden der Philosophie zu verschreiben. Enttäuscht von Politik und Praxis haben sich zuletzt manche damit begnügt, Philosophie primär als wissenschaftliche Erkenntnistheorie zu betreiben. Wird dahingegen zwischen Theorie, Praxis und Poiesis unterschieden, indem durch begriffliche Bestimmungen die spezifischen Differenzen zwischen diesen Handlungsweisen mit ihrem je besonderen Wirklichkeitsbezug benannt werden, können die jeweilige Eigenständigkeit eben so wie die wechselseitige Ergänzung und Begrenzung von Theorie, Praxis und Poiesis erkannt werden; was wiederum der Politikberatung und Praxisbegleitung zugute kommt. Erst nachdem Philosophen nicht mehr um jeden Preis praktisch werden und ihre Eigenständigkeit aufgeben wollten, konnten sie die spezifische Erfahrungsweise der Praxis angemessen würdigen. Auch konnte der vermessene Anspruch aufgegeben werden, die Kenntnisse aller Einzelwissenschaften zu besitzen, und die „methodische Erkenntnis mit dem Wissen von der jeweiligen Methode“ (Jaspers, a.a.O. S. 95) als eines der zentralen Prinzipien der modernen Wissenschaft anerkannt werden. Wenn daher Philosophen heute auf empirische, intersubjektiv nachvollziehbare Befunde der Wissenschaften rekurrieren, zeugt dies nicht zuletzt davon, dass sich von ihrer zwischenzeitlichen Selbstaufgabe wie Überforderung in der Moderne wieder verabschiedet haben und nicht mehr länger die Philosophie als absolute Wissenschaft mit dem Ziel etablieren wollen, „ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein“, wobei Wissen angeblich „nur als Wissenschaft oder als System wirklich“ sei bzw. als „Enzyklopädie“ (G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, 1980, S. 11/21, hier zitiert nach: O. Marquard, Philosophie. In: Hist.Wb.Philos.7 Sp. 718).
Philosophen können eine kritische Funktion für die übrigen Praxisformen übernehmen, indem sie weiterhin die Frage nach dem Ganzen und den Teilen, dem Allgemeinen wie dem Besonderen stellen. Mithin sind Fragen nach dem unbedingten Grund, den ersten Ursachen und Prinzipien auch dann noch zu stellen, wenn sie sich nicht oder nicht vorschnell beantworten lassen. Wer weiß, dass er das Ganze nicht kennt, verkennt nicht durch vorschnelle Verallgemeinerung einer Handlungsweise das Gemeinsame zwischen Theologie, Philosophie, Wissenschaft und Praxis. Wünschenswert ist dies, weil auch Wissenschaftler oder Praktiker bisweilen die Unterschiede zwischen ihren spezifischen Denkformen und Handlungsweisen außer Acht lassen und in mehr oder minder blinde Wissenschafts-, Praxis- oder Technikgläubigkeit verfallen können. Nicht nur die Theorie wird gelegentlich noch um ihrer selbst willen betrieben, so dass diese nicht einmal mehr als die höchste Form der Praxis angesehen werden kann. Auch Wissenschaft, Praxis oder Poiesis können unbemerkt zum Selbstzweck erhoben werden, wenn methodische, praktische oder poietisch-technische Bedingtheiten dieser Praxisformen nicht hinreichend ausgewiesen werden. Nachdem Philosophen nicht mehr länger die Magd der Theologie sein wollten, gerieten sie in der Moderne jedenfalls umgehend in die Gefahr, sich der Politik, der Praxis und den Wissenschaften zu verschreiben und sich auch auf diese Weise mehr oder weniger selbst aufzugeben. Mitunter haben Philosophen jedoch auch einen Lernprozess von der Überforderung hin zur ernüchterten Anerkennung der Unterschiede durchlaufen (vgl. Marquard, a.a.O. Sp. 714ff). Ab und zu haben sie sogar daran erinnert, dass Menschen rationale Lebewesen (zôon noêtikon) sind, die Vernunft besitzen und am Seinsgrund (nous) partizipieren, ohne darüber zu vergessen, dass sie auch leibliche und politische Lebewesen sind, die an allen weltimmanenten Seinsschichten teilhaben (vgl. E. Voegelin, Vernunft: Die Erfahrung der klassischen Philosophen. In: Ders: Ordnung, Bewußtsein, Geschichte, Stuttgart 1988, S. 127ff. und 162ff. Siehe auch: ders.: Was ist politische Realität?. In: ders.: Anamnesis – Zur Theorie der Geschichte und der Politik, München 1966, S. 340ff.). Nicht zuletzt aus diesem Grunde ziehen wir die Philosophie als Metawissenschaft den heutigen Kulturwissenschaften bei unserer Beratungspraxis vor. Zumal diese als relativ junge und typisch moderne Wissenschaft noch zwischen theoretischer Unterbestimmung und praktisch-enzyklopädischer Selbstüberanspruchung schwanken. Obschon Kulturwissenschaftler den Topos der Kultur und damit die relative Eigenständigkeit ihres spezifischen Forschungsgegenstands noch nicht hinreichend haben bestimmen können, ist es ihnen Ende des vorigen Jahrhunderts mit dem so genannten Cultural Turn gelungen, sich gegenüber philosophischen und geistes- wie gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten zu behaupten und als neue Wissenschaftswissenschaft oder Universalwissenschaft zu etablieren. Zwar eröffnen auch die Kulturwissenschaften der interdisziplinären Zusammenarbeit neue Perspektiven. Die Philosophie als Metawissenschaft für interkulturelle Forschungsvorhaben ermöglicht indes Wissenschaftlern wie Praktikern eine Selbstdistanzierung von ihrer eigenen Profession und Praxis, die mitunter bitter Not tut, mitunter aber auch entlastend und erheiternd ist.